|
Schwäbisches
Tagblatt/Südwestpresse,
Montag, 10. November 2008, S.23.
Neue Formen
der Erinnerung
Tübingen gedachte am
Synagogenplatz, vor dem Rathaus und in der Stiftskirche der Pogromnacht
Mit einem Gang vom Synagogenplatz
zum Rathaus und einer Gedenkstunde in der Stiftskirche erinnerte Tübingen
gestern an Opfer und Täter der Pogromnacht vor 70 Jahren.
Autor:
Achim Stricker
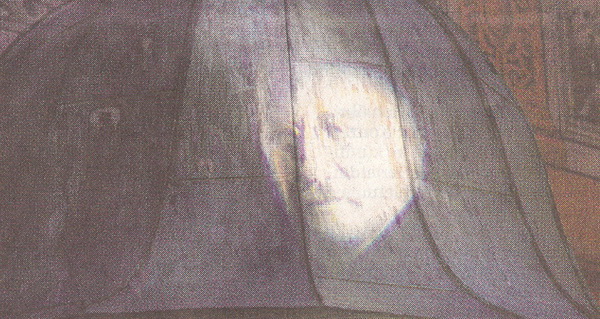
Simon Hayum, vergangene Woche
per Lichtinstallation auf die Kuppel des Rathausbalkons projiziert,
Bild: Hantke

Am Synagogenplatz erinnerte Martin Ulmer an den Brand der Tübinger
Synagoge in der Nacht zum 10. November 1938.
Bild: Faden
Tübingen. Der
Erinnerung ein Gesicht geben. Das ist ein zentrales Anliegen des Tübinger
"Netzwerks gegen das Vergessen". Besonders dort, wo jüdische
Kultur so umfassend ausgelöscht wurde wie am Synagogenplatz in
der Gartenstraße. Dort, wo in der Nacht zum 10. November 1938
die Synagoge geschändet und in Brand gesteckt wurde, versammelten
sich gestern am späten Sonntagnachmittag 150 Menschen.
Martin Ulmer von der Geschichtswerkstatt
schilderte die Vorgänge der Tübinger Pogromnacht und den Verlust
jüdischen Lebens in der Stadt. Ulmer machte aber auch deutlich,
dass es nicht nur darum gehe, der Opfer zu gedenken. Auch auf der Täterseite
herrsche nach wie vor Erinnerungsbedarf: Ein Teil der Täter ist
bis heute namentlich unbekannt.
In der Nacht zum 10. November
1938 kam eine Gruppe SS- und SA-Leute von einem Fest aus dem Museum,
drang gegen Mitternacht in die Synagoge ein und verwüstete sie.
Eine zweite Tätergruppe steckte gegen vier Uhr morgens das Gebäude
in Brand, Schaulustige fachten das Feuer am nächsten Morgen immer
wieder an. In den diversen Kirchengemeinderatssitzungen am darauffolgenden
Abend wurde der Vorfall schlicht ignoriert. Nur ein einziger Protest
kam - von einem SA-Studenten.
Der Erinnerung ein Gesicht
geben: Vergangene Woche wurde jeden Abend mit Einbruch der Dämmerung
das Gesicht eines anderen vertriebenen oder ermordeten Tübinger
Juden auf die Rathausfassade projiziert. Da und doch kaum zu fassen,
schwebten sie unwirklich über den Konterfeis der prominenten Stadtsöhne
Dann, Osiander oder Uhland.
Nicht "überstrahlt"
wurde Graf Eberhard im Bart, obwohl er 1477 die Juden des Landes verwiesen
hat. Am Sonntag wurden fünf Transparente mit den Namen aller 101
Tübinger Jüdinnen und Juden ausgerollt: Familien wie Spiro,
Zivi, Katz, Marx, Koppel, Lion, Erlanger oder Bernheim. 80 Mitglieder
dieser Familien sind 1939 in die USA oder nach Palästina emigriert,
20 wurden deportiert. Nur zwei der Verschleppten überlebten. Hanna
Bernheim konnte 1939 in die USA emigrieren. Zu der Gedenkveranstaltung
am Sonntag war ihre Tochter Doris Doktor mit Tochter Ruth und Enkelin
Leigh aus den Staaten angereist.
300 Menschen versammelten
sich auf dem Marktplatz, wo Oberbürgermeister Boris Palmer auf
die "jüngste Tübinger Stadtgeschichte" verwies:
"Wir haben bis heute gebraucht, um diesen Teil der Geschichte aufzuarbeiten."
Der KZ-Überlebende Viktor Marx stellte bereits 1949 auf dem Wankheimer
jüdischen Friedhof eine Gedenktafel für die Opfer auf. Eine
Tafel von städtischer Seite hat Palmer erst in diesem Jahr eingeweiht.
Auch er stellte klar, dass der Prozess des Erinnerns längst nicht
abgeschlossen sei: "Die Debatte ist nicht zu Ende, wir werden diese
Diskussion weiter führen." Nicht nur gehe es nach wie vor
um die Frage: "Wie gehen wir um mit der Schuld, die wir auf uns
geladen haben?" Für viele Opfer des Dritten Reiches "haben
wir noch keine Form des Erinnerns gefunden", meinte Palmer mit
Verweis auf den Tübinger Liberaldemokraten Simon Hayum. Derzeit
arbeitet die Kommission "Kultur des Erinnerns" das Schicksal
vertriebener jüdischer Stadträte auf.
Sprecher(innen) des "Netzwerks
9. November" verlasen zuletzt die Namen aller vertriebenen und
ermordeten Tübinger Jüdinnen und Juden.
Gewalttat und Hader in der
Stadt
Musik von jüdischen
Komponisten rahmte die anschließende Gedenkstunde der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in der Stiftskirche, zu der rund 600 Besucher zusammenkamen.
Organistin Heidi Grözinger spielte Werke von Louis Lazarus Lewandowski
und Paul Ben-Haim, der Stephanuschor unter Hans-Walter Maier sang zwei
Motetten von Mendelssohn.
Friedhilde Dieterich, Irene
Kosel und Hartmann Doerry schilderten noch einmal die Vorgänge
der Tübinger Pogromnacht und ihre Folgen. So kassierte der Staat
von allen Juden eine kollektive Geldstrafe und bei der Emigration eine
"Reichsfluchtsteuer" - insgesamt zwei Milliarden Reichsmark.
Aber auch die Bevölkerung bereicherte sich, und in Tübingen
"freute man sich über manches Schnäppchen".
Daniel Felder vom Tübinger
jüdischen Verein "Bustan Shalom" sprach von der "Effizienz
und Berechnung einer von jeglicher Menschlichkeit losgelösten Bürokratie".
Zentraler Text war der 55.
Psalm: "Gewalttat und Hader in der Stadt". "Der Psalm
fordert uns heraus", meinte Stephanuskirchenpfarrer Ulrich Zeller:
"Die Kirche hat Seite an Seite mit dem Volk Gottes zu stehen, wir
sind im Namen Jesu zur Demut gegenüber dem Judentum angehalten,
zur Dankbarkeit für die Teilhabe im Glauben an den Gott Israels".
Die Gedenkstunde schloss mit dem gemeinsamen "Ose shalom bimromav"
aus dem jüdischen Kaddisch als Segen für die Toten.
Texte der
Feierstunde zur Reichspogromnacht in der Stiftskirche am 9. November
2008, 18 Uhr:
Programm
Liedblatt
Texte
der Feierstunde
Schwäbisches
Tagblatt/Südwestpresse,
Samstag, 8. Dezember 2007, S. 34.
Frieden
und Freude
nur für kurze Zeit
Heute vor 125
Jahren weihte die Tübinger jüdische Gemeinde in der Gartenstraße
ihre Synagoge / Von Hans-Joachim Lang
"Dank verschiedener
privater Initiativen gibt es einen Synagogenplatz, wo seit 29 Jahren
wenigstens erinnert wird, was an diesem Platz fehlt und seit neun Jahren
auch, warum. Am heutigen Samstag wird erstmals seit 1932 von einem Tübinger
jüdischen Verein an die Einweihung der alten Synagoge gedacht.
Darin liegt viel Wehmut und Trauer, aber auch Hoffnung für die
Zukunft."
Mehr über die Synagoge
in der Gartenstraße 33
und den Synagogenbrand:
http://de.wikipedia.org/wiki/Synagoge_%28T%C3%BCbingen%29
http://www.alemannia-judaica.de/tuebingen_synagoge.htm
http://www.tuepedia.de/index.php/Synagoge
http://www.gedenkstaetten-bw.de/gedenkstaetten_anzeige.html?&tx_lpbgedenkstaetten_pi1[showUid]=510&cHash=8d72affe6d
http://www.bonhoeffer-gemeinde.de/juden/denkmal_ortsgeschichte.htm
http://www.tuebingen.de/1560_10984.html
http://www.tuebingen.de/1560_8026.html
|