|
|
|||
... aus der
Tagespresse
|
|||
|
Schwäbisches Tagblatt Samstag, 11. Januar 2003 Wort
zum Sonntag
|
|
|
Zur Solidarität
begabt
Sternsingeraktion 2003 in
der St. Johannes-Gemeinde. 30 Kinder klingeln in drei Tagen an fast
300 Tübinger Türen. Bei Familien, Singles, in Altenheimen,
beim SWR, in Kaufhäusern und auf öffentlichen Plätzen
singen sie. Zur Ehre Gottes, zur Freude aller, die sie besuchen, und
zur finanziellen Unterstützung eines Projekts für Aids-Waisen
in Kenia.
Fast 5000 Euro sind dabei
zusammengekommen. Ganz unspektakulär, selbstverständlich,
alltäglich verwirklichen die Sternsingerkinder immer zu Beginn
des neuen Jahres die Botschaft des Dreikönigsfestes: "Gott
ist Mensch geworden; er will bei den Menschen sein, er kommt zum Heil
und Segen aller." Was in Bethlehem geschehen ist, wird jetzt öffentlich.
Sterndeuter, Weise aus dem Osten kommen zum Kind in der Krippe; Männer
aus der ganzen damals bekannten Welt. Das Licht Gottes ist erschienen
für alle Völker und Zeiten.
Weihnachten ist eine Sache
der Welt geworden. Das sagen die Sternsingerkinder in ihren Sprüchen,
und sie singen es in ihren Liedern allen, die es hören wollen.
Hautfarbe, Nationalität und Religionszugehörigkeit spielen
dabei keine Rolle. Sie tun es übrigens in allen katholischen Kirchengemeinden
unserer Stadt. Unzählige sind es in ganz Deutschland. Die Kinder
sind bereit, neue Erfahrungen zu machen, andere Menschen kennen zu lernen
und sich berühren zu lassen von dem, was sie erleben.
Und während sie ihre
Aufgabe als Sternsinger erfüllen, zeigen sich die verschiedenen
Gaben Gottes, mit denen die Kinder ausgestattet sind: ihre Fähigkeit,
sich zu begeistern; ihre Unerschrockenheit, auch im strömenden
Regen, bei Gewitter oder klirrender Kälte von Haustür zu Haustür
zu gehen; ihre Offenheit und Unvoreingenommenheit, fremden Menschen
zu begegnen und dabei manches Besondere zu erleben, zum Beispiel dass
ein alter Mann weint, während sie in seinem Haus sind. Die offensichtlichste
Gottesgabe der Kinder ist die Freude; die ist besonders zu spüren,
wenn sie abends zurückkommen und zuerst, vor allem anderen, neugierig
und stolz das ersungene Geld zählen, als wäre es ihr eigenes;
sie ist zu spüren, wenn sie die Süßigkeiten aufteilen,
die sie selbst als Belohnung für ihren Dienst geschenkt bekommen,
und schließlich, wenn sie begeistert davon erzählen, welche
Leute sie getroffen haben, wie viele, vor allem Einsame, über ihren
Besuch gerührt sind.
Bemerkenswert bei dieser
jährlichen Aktion Anfang Januar ist außerdem das Gespür
der Kinder für Gerechtigkeit. Es ist beeindruckend, wie beim Verteilen
der Süßigkeiten selbst einzelne Gummibärchen oder Smarties
noch gerecht ausgezählt werden, damit sicher niemand zu kurz kommt;
auch, dass die Kinder das Geld, das sie ausdrücklich für sich
persönlich geschenkt bekommen, ganz selbstverständlich eben
nicht für sich behalten, sondern in ihre Sammelbüchse stecken.
Menschen sind zur Freude
und zur Solidarität begabt. Allerdings, was Kinder oft noch unmittelbar
und selbstverständlich leben, verkümmert bei Erwachsenen manchmal
im Lauf ihrer Lebenserfahrungen. Während ich die Kinder auf ihren
Wegen durch Tübingen begleite, ist mir jedes Jahr wieder bewusst,
wie reich es macht, diese menschlichen Grundbegabungen eben nicht verkümmern
zu lassen, sondern sie zu pflegen.
Schwäbisches Tagblatt, 21. Dezember 2001
So als sei Ethik delegierbar
Bischof Gebhard Fürst kritisiert, wie
das Statement zum Stammzellen-Import veröffentlicht wurde
ROTTENBURG (ski). "Erstaunt
und befremdet" hat Gebhard Fürst, den Rottenburger Bischof
und Vertreter der katholischen Kirche im Nationalen Ethikrat, dass das
Statement dieses Rates zum Import embryonaler Stammzellen nun ohne Pressekonferenz
und weitere Kommentierung veröffentlicht wurde. "Zurn alleinigen
Feststellen von Mehrheitsverhältnissen", so Fürst gestern,
"wäre die ganze interne Beratungsarbeit des Gremiums nicht
nötig gewesen."
Die Art und Weise, wie die endgültige Fassung des Papiers jetzt
publiziert werde, entspricht für den Bischof nicht den im Ethikrat
getroffenen Vereinbarungen. Zudem verstärke sie nochmals den in
der Öffentlichkeit ohnehin schon entstandenen Eindruck, als habe
das Gremium eine Mehrheitsentscheidung gefällt oder eine Empfehlung
getroffen. Beides jedoch treffe nicht zu: "Der Ethikrat hat keinerlei
Legitimation, als Entscheidungsgremium aufzutreten."
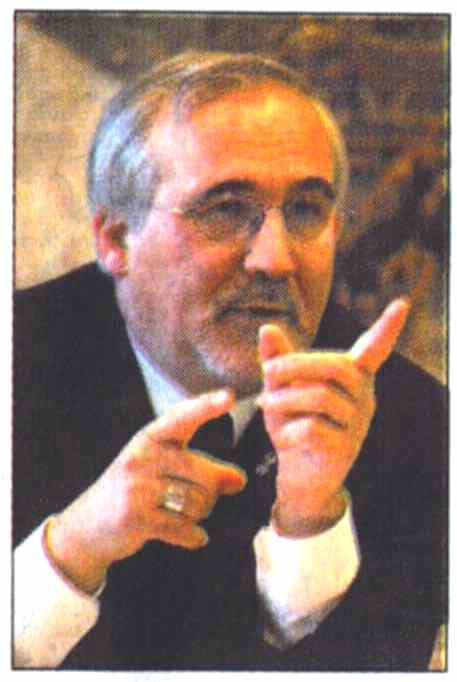
Gebhard Fürst
Vielmehr sei
seine Aufgabe, durch seine Beratung das ethische Urteil von Entscheidungsträgern
zu unterstützen und zu fördern. Die 35-seitige Stellungnahme
des Rates, die das Pro und Contra eines Stammzellen-Import darstelle,
diene der eigenen Urteilsfindung und der öffentlichen Diskussion.
Außerdem, so Fürst, stehe sie unter einem "Vorläufigkeitsvorbehalt",
weil das Gremium die Frage nach der Zulässigkeit der Forschung
an embryonalen Stammzellen zwar erörtert hat, "ohne dabei
jedoch zu einem abschließenden Urteil zu gelangen", wie es
in dem gestern veröffentlichten Dokument heißt.
Letztlich sprachen sich in dem Statement 15 Mitglieder des Ethikrates
für einen befristeten und an strenge Bedingungen geknüpften
Import embryonaler Stammzellen aus, neun von ihnen zugleich für
eine Gewinnung von Stammzellen aus so genannten überzähligen
Embryonen auch im Inland. Auf der anderen Seite votierten zehn Mitglieder
für eine vorläufige Ablehnung des Stammzellen-Imports. Vier
von ihnen, darunter auch Bischof Fürst, lehnten den Import als
ethisch unzulässig grundsätzlich ab.
Trotz dieses, so Fürst, "nicht überbrückbaren Dissenses"
bestehe in anderen Punkten Einigkeit innerhalb des Gremiums. Etwa darin,
dass Forschung an embryonalen menschlichen Zellen elementaren Verfassungsprinzipien
wie der Menschenwürde und dem Lebensschutz widerspreche, dass die
Unantastbarkeit dieser Prinzipien entscheidender Bezugspunkt für
das ethische Urteil sei und dass vor vorschnellen Erwartungen an Therapie-Erfolge
aus solchen Forschungsvorhaben heraus gewarnt werden müsse. Außerdem
spricht sich der Ethikrat dafür aus, die weniger umstrittenen Forschungsansätze
mit nicht-embryonalen Stammzellen "nachdrücklich" zu
verfolgen. Wirtschaftliche Gesichtspunkte dürften, wenn Ethik und
Verfassung es verbieten, bei der Entscheidung "keine Rolle spielen."
Während aber die Befürworter des Stammzellen-Imports Embryonen
je nach Entwicklungsstadium abgestufte Grade von Menschenwürde
zuerkennen, ist die katholische Position in diesem Punkt schlicht: "Mit
der Verschmelzung von Ei und Samenzelle beginnt das Leben eines Menschen.
Ihm kommt von allem Anfang an Menschenwürde und absolut Schutzwürdigkeit
zu. Weil die Gewinnung von Stammzellen aus menschlichen Embryonen aber
deren Tötung voraus setze, sei so genannte verbrauchende Embryonenforschung
ethisch nicht zu verantworten. Dies gelte in gleichem Maße auch
für den Import derartiger Stammzellen.
"Mich leitet in dieser Frage kein Dogmatismus", sagte Fürst
gestern der Presse, "sondern die Sorge, dass wir einen Weg einschlagen,
der zur totalen Verfügbarkeit alles Menschlichen führen könnte.
Eine Spaltung der Gesellschaft in Menschen, die geworden und solche,
die gemacht sind, würde den Verlust der Freiheit bedeuten. Erst
der Respekt vor dem Heiligen, der "kein kirchliches Sondergut"
sei sichere Humanität und schütze vor Allmachtsfantasien und
Machbarkeitswahn. Schließlich habe der Verzicht auf eine ethische
Grundorientierung in Wissenschaft und Forschung uns im vergangenen Jahrhundert
furchtbare Katastrophen beschert." Bild: Mozer
Schwäbisches Tagblatt, 30.10.01
Drei Tübinger ketteten sich ans Innenministerium
Tübingerin beobachtete Prozess in Istanbul
Es gibt Tage, da ist man
stolz Tübinger/in zu sein! Lesen Sie die beiden Artikel unter der
Rubrik "Tübinger Kirchenasyl
-
Pressemitteilungen zum Tübinger Kirchenasyl"
Schwäbisches Tagblatt, 05.07.01, Pressestimme:
Neugier statt Angst
Die „Lausitzer Rundschau“ (Cottbus) kommentiert die Kritik des Europarates am ausländerfeindlichen Klima in Deutschland:
Der Europarat hat in Deutschland ein allgemeines Klima von Rassismus, Intoleranz und Antisemitismus festgestellt. Natürlich kann man nicht alle Deutschen über einen Kamm scheren. Es ist auch kein spezielles ostdeutsches Problem, wie der Europarat hervorhebt...
Dennoch verebben
nach den großen Kampagnen gegen Rassismus und Antisemitismus immer
wieder die Stimmen der Vernunft. Deshalb ist so ein Signal aus dem Ausland
wichtig, so sehr es uns auch trifft. Wir dürfen weder die Straße
noch die Stammtische jenen überlassen, die nur in Schwarz-Weiß-Schablonen
denken, Vielfalt nicht ertragen können. Die Angst muß Neugier
weichen und Zivilcourage. Gegen den alltäglichen Rassismus reicht
keine Wut. Dafür braucht es Mut.
Internet/Aachener Zeitung, 30.06.01, 12:45 Uhr
Grönemeyer: Kampf gegen Fremdenhass viel zu lasch
Aachen (dpa) –
Herbert Grönemeyer (45), Sänger, Komponist und Schauspieler,
ist die Bekämpfung des Fremdenhasses zu lasch. „Was die Politik
seit Jahren leistet, ist eine Unverschämtheit“, sagte er
in einem Interview der „Aachener Zeitung“ (Samstag).
Die Regierung verstecke
sich hinter ein paar medienwirksamen Lippenbekenntnissen, die CDU schüre
den Fremdenhass mit dem Begriff der Leitkultur, andere stritten lieber
über BSE, Rente und Ökosteuer. In Wahrheit seien die Folgen
der Wiedervereinigung und der extreme Rechtsruck die einzigen Probleme
für die deutsche Demokratie. „Ich sehe hier nicht genug Leute,
die intellektuell erfassen können, worum es gerade geht“,
sagte der Sänger der Zeitung weiter.
Schwäbisches Tagblatt vom 5.5.2001, S. 25:
Flüchtiger vom Hubschrauber entdeckt
TÜBINGEN. Mit einem Hubschrauber, der im Tiefflug über der Stadt kreiste, machte sich die Polizei gestern auf die Suche nach einem 16-jährigen Algerier. Der Asylbewerber, der „wegen mehrfacher Verstöße gegen das Asylverfahren“ schon im Februar zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war, musste gestern zum Haftrichter, weil er mehrmals ohne Erlaubnis den Kreis Tübingen verlassen hatte. Als der 16-Jährige dann von Beamten in seine Unterkunft in die Weststadt begleitet wurde, um dort persönliche Sachen für den Haftantritt zu packen, türmte er. Mit Hilfe des Polizei-Hubschraubers wurde er aber wenig später gefunden: Er hatte sich in der Nähe der Westbahnhofkreuzung im Ammer-Gebüsch versteckt.
Dazu die Leserbriefe im Schwäbischen Tagblatt:
Mittwoch, 9. Mai 2001
Nach einem 16-jährigen Flüchtling, der hier Asyl sucht, wurde per Hubschrauber gefahndet, weil er „mehrmals ohne Erlaubnis den Kreis Tübingen verlassen“ hat.
»Flüchtlingsbekämpfung«
Macht sich ein Jugendlicher strafbar, wenn er sich von Tübingen nach Reutlingen begibt? Alle, denen diese Frage absurd erscheint, wissen immer noch nicht, dass es in unserem Staat eine Reihe von rassistischen Sondergesetzen gibt, die nur einen Zweck verfolgen: Nichtdeutsche zu schikanieren, zu demütigen, zu kriminalisieren.
Die Frage muss also mit „Ja“ beantwortet werden, wenn es sich bei dem Jugendlichen um einen Flüchtling handelt. Rechtliche Grundlage für diese „Straftat“ ist Paragraf 56 des Asylverfahrensgesetzes, die so genannte Residenzpflicht. Demnach ist die „Aufenthaltsgestattung räumlich auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt“. Mit anderen Worten: Wer seinen Landkreis verlässt, macht sich strafbar.
Einem 16-jährigen (!) Algerier wurde dies nun zum Verhängnis: Weil er mehrmals den Landkreis Tübingen verlassen hatte, sollte er in den Knast. Es gelang ihm jedoch, zu fliehen, was die Polizei zu einer Großfahndung veranlasste, als wäre ein bis an die Zähne bewaffneter Schwerverbrecher entkommen. Vom Hubschrauber aus wurde er schließlich aufgespürt. Wer sich an dieser Stelle fragt, ob unsere Polizei nichts Sinnvolleres zu tun hat, weiß immer noch nicht, dass Flüchtlingsbekämpfung in den letzten Jahren zu einer der polizeilichen Hauptaufgaben geworden ist.
Nun sitzt der Jugendliche also doch im Knast und hat miserable Aussichten für die Zukunft. Denn auch wenn Algerien auf Grund seiner Menschenrechtsverstöße gerade in diesen Tagen wieder Schlagzeilen macht: Algerische Asylbewerber haben in Deutschland kaum eine Chance! Wahrscheinlich geht die Haft also nahtlos in Abschiebehaft über.
Aber es regt sich Widerstand: Flüchtlingsorganisationen mobilisieren für die Tage 17. bis 19. Mai nach Berlin zu Aktionstagen gegen die Residenzpflicht. Im Aufruf dazu heißt es: „Bewegungsfreiheit ist nicht verhandelbar und sollte in jeder demokratischen Gesellschaft geschützt werden, denn sie ist die Grundlage, auf der sich die menschliche Persönlichkeit erst entwickeln kann ... Nieder mit der Residenzpflicht, den Apartheid-Gesetzen Deutschlands! Bewegungsfreiheit ist unser Recht!“
Johannes Mahn, Tübingen, Riedkelterweg 27
»GSG 9 gegen Schwarzfahrer«
Ein 16-Jähriger wird mit dem Polizeihubschrauber durch die Stadt gejagt. Unter anderem weil er gegen die Residenzpflicht verstoßen hat. Die besagt, Asylbewerber dürfen die Landkreisgrenzen nicht überschreiten. Sie dürfen also zum Beispiel nicht von Tübingen nach Reutlingen fahren. Das ist ein schweres Vergehen. Das wird streng verfolgt. Ja, wo leben wir eigentlich? Menschenjagd per Hubschrauber. Nach Reutlingen fahren ein Verbrechen. Welchen Köpfen sind denn solche Anweisungen und Gesetze entsprungen? Das ist doch nicht der Wilde Westen hier! Kann man nur hoffen, dass nicht demnächst Panzer gegen Falschparker und die GSG 9 gegen Schwarzfahrer eingesetzt werden.
Timon Haidlinger, Tübingen, Schellingstraße 6
»Inhuman«
Das darf ja wohl nicht wahr sein. Da jagt Polizei per Hubschrauber im Tiefflug einen 16-jährigen Jungen wie einen Schwerverbrecher. Was hatte der Junge, ein algerischer Asylbewerber getan? Laut TAGBLATT hatte er sich mehrmals unerlaubt aus dem Landkreis Tübingen entfernt. Verglichen mit diesem Delikt sind die polizeilichen Maßnahmen mehr als unverhältnismäßig. Sie sind inhuman.
Renate Kugler, Tübingen, Ampferweg 18
Das TAGBLATT berichtete am Samstag nicht nur über diese Tiefflug-Fahndung („Flüchtiger vom Hubschrauber entdeckt“), sondern auch über Zwangsarbeiter in Tübingen.
»Heute nicht sehr viel besser«
Eines gleich vorweg: Mit den folgenden Gedanken möchte ich keinesfalls die heutigen Zustände mit dem Nationalsozialismus gleichsetzen und letzteren dadurch verharmlosen. Wir leben heute nicht in einem faschistischen Staat, sondern in einer bürgerlichen Demokratie. Freilich ist auch dieser Rechtsstaat schon schlimm genug.
Nun zur Sache: Mit Interesse las ich die Extra-Seite über Zwangsarbeiter/innen in Tübingen – doch erscheinen mir einige Aspekte erschreckend aktuell. Im Artikel „In primitivem Zustand“ wird über das ehemalige Zwangsarbeiterlager in der Marquardtei berichtet. Heute, sechzig Jahre später, befindet sich in der gleichen Straße, lediglich ein paar Meter stadtauswärts, ein Lager, das ähnliche Charakteristika aufweist. Auch im Flüchtlingslager Herrenberger Straße lassen sich „miserable hygienische Bedingungen“ bemängeln. Pro Zwangsarbeiter standen nur 3,75 Quadratmeter Fläche zur Verfügung – pro Flüchtling sieht es heute nicht viel besser aus!
In dem Interview „... ein sonniges Ding“ heißt es: „Auf dem Rückweg gab es im Zug einen Riesenärger, denn als Zwangsarbeiterin hätte Pascha die Kreisgrenze nicht überschreiten dürfen. Nur dank der großen Überredungskunst meiner Mutter entkamen wir dieser höchst brenzligen Situation.“
Derselben Ausgabe des TAGBLATTS entnehme ich, dass sechzig Jahre später ein junger Algerier in eben diese brenzlige Situation geraten war – und ihr nicht entkommen konnte. Denn als Asylbewerber hätte er die Kreisgrenze nicht überschreiten dürfen! Dafür wird er jetzt ins Gefängnis eingewiesen.
Müssen erst sechzig Jahre vergehen, bis ins öffentliche Bewusstsein dringt, welches Unrecht heute geschieht?
Sabine Hess, Tübingen, Provenceweg 3
Samstag, 12. Mai 2001
Am 4. Mai fahndete die Polizei in Tübingen per Hubschrauber nach einem 16-Jährigen Flüchtling, der hier Asyl sucht, weil er „mehrmals ohne Erlaubnis den Kreis Tübingen verlassen“ hat.
»Beschämendes Beispiel«
Am Freitag, 4. Mai, spielte sich im Tübinger Westen ein eindrucksvolles Szenario ab. Zwei Stunden dauerte eine Suchaktion – mehrere Streifenwagen, Motorräder, Zivilpolizisten waren im Einsatz. Zivilpolizisten verließen ihre Autos, legten sich auf den Boden, um unter Gartenhäuser nach dem Entwichenen zu suchen. Eine gute Stunde lang kreiste der Polizeihubschrauber im Tiefflug über Wohnhäuser und Gärten, sodass ein Telefonat nur noch schwer möglich war: Es entstand eine äußerst bedrohliche Situation, Anwohner waren verunsichert. Bankräuber, Schwerverbrecher, Mörder, Raubüberfall waren Überlegungen. Es handle sich um einen „harmlosen Jugendlichen in Handschellen“, der bei der Festnahme entflohen sei, erfuhr man von der Polizei, was für mich mit dem großen Polizeiaufgebot nicht in Einklang zu bringen war. Die Aussage, es handle sich um einen ungefährlichen Jungen, beruhigte mich wenig. Vielmehr fragte ich mich, wie es diesem Jugendlichen gehen müsse, der so gejagt wird. Selbst der harmloseste Mensch kann angesichts einer solchen Bedrohung zu unvorhersehbarem Tun neigen.
Ernüchternd und schockierend fand ich dann die Tatsache, die ich am Samstag im SCHWÄBISCHEN TAGBLATT las, dass dieser 16-jährige Junge vermutlich in Abschiebehaft gebracht werden sollte. Dass man so eine Menschenhatz auf einen 16-jährigen (man beachte: in Handschellen gelegten!) bei Abschiebung eventuell tödlich bedrohten Jungen machen muss, wirkte auf mich empörend. Hautnah bekamen wir ein schockierendes Politikum vorgeführt, was unsere Asylpolitik angeht – ein beschämendes Beispiel.
Sabine Klever Tübingen,
Justinus-Kerner-Straße 20
![]()
„Keine Umkleide für türkischen Verein“: Beim SV Wannweil lehnte eine knappe Mehrheit die Mitbenutzung der Kabinen durch die Türkische Gemeinschaft Wannweil ab. Der SV-Vorstand trat daraufhin zurück (TAGBLATT, 2. Mai).
»Unsäglich«
In dem am 2. Mai erschienenen Artikel steht auszugsweise Folgendes: Der Wannweiler Sportverein (SV) hat mit hauchdünner Mehrheit beschlossen, dass die neu gegründete „Türkische Gemeinschaft Wannweil e.V.“ (TG) die Kabinen und Duschen des SV nicht mitbenutzen darf. Daraufhin trat der Vorstand des SV geschlossen zurück. Der ebenfalls zurückgetretene Vorsitzende Wahl findet den Ausschluss der türkischen Kicker nicht gut. „In erster Linie ältere Mitglieder“, so Wahl, hatten schon im Vorfeld Bedenken geäußert. Dabei seien jedoch seines Wissens nie rassistische Bemerkungen gefallen. Vielmehr hätten langjährige Mitglieder, die das Vereinshaus noch mit ihren eigenen Händen aufgebaut haben, ihr Lebenswerk gefährdet gesehen.
Wir begrüßen den Rücktritt des Vorstands des SV. Das Argument, die Mitbenutzung der Duschen durch den TG gefährde das Lebenswerk älterer SVler, finden wir unsäglich. Ein trauriger Beweis dafür, dass Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Es tut uns leid, was sich die TG-Mannschaft da anhören und auch ertragen muss. Wir fordern den SV Wannweil auf, die Entscheidung schleunigst zurückzunehmen.
Gabi Buck für
das Zentralamerika-Komitee, Tübingen, Hechinger Straße 21
![]()
Im Schwäbisches Tagblatt vom 9.5.2001, S.2, steht folgender Leitartikel:
Der Weltseelsorger
Sabine Seeger-Baier, Rom
Konsequent verfolgt Johannes Paul II. seine Mission für den Frieden in der Welt und die Versöhnung der Religionen. Trotz fortschreitender Krankheit und körperlicher Gebrechlichkeit – mit „heiliger Sturheit“ setzt der fast 82-Jährige seinen vom Stolpern bedrohten Schritt fort – und wie es scheint, am liebsten in vermintes Gelände. So war auch die Pilgerreise auf den Spuren des Apostel Paulus gewiss kein Spaziergang: Kühl der Empfang in Griechenland, spektakulär der Besuch in einem islamischem Gotteshaus, riskant der Abstecher auf die Golan-Höhen.
In Athen nahm er den Orthodoxen, die den „Antichristen aus Rom“ als unwillkommenen Gast nur unterm Geläut der Totenglocken duldeten, mit seiner Demutsgeste den Wind aus den Segeln. Seine Bitte um Verzeihung für die „Taten und Unterlassungen“ der von Katholiken begangenen Sünden an den „orthodoxen Brüdern und Schwestern“ brach nicht nur das uralte Misstrauen. Das Mea culpa öffnete auch zum ersten Mal nach der Spaltung zwischen griechischer Orthodoxie und römisch-katholischer Kirche im Jahr 1054 die Tür zum Dialog.
Es war eine große, eine mutige Geste, auch gegenüber den Konservativen aus den eigenen Reihen. Den Bewahrern des Katholizismus als des wahren Glaubens war und ist dieser „Gang nach Canossa“ ein Dorn im Auge.
Als historisch möchte man den Besuch der Omijaden-Moschee bezeichnen, gäbe es nicht schon so vieles im Wirken dieses Pontifex, das den Begriff „historisch“ verdient. Schon 1986 begann Johannes Paul II. mit der Eroberung päpstlicher Terra incognita: Damals betete er als erster Papst in der langen Geschichte der Kirche in einer Synagoge, der von Rom. Im vergangenen Frühling, mitten im heiligen Jahr von Mutter Ekklesia, schritt er mit der Bitte um Versöhnung zwischen Juden und Christen an die „Klagemauer“, die Westmauer des alten jüdischen Tempels von Jerusalem. In Damaskus wagte er noch einmal Neues: Als erster Papst der Christenheit setzte er seinen Fuß in ein muslimisches Gotteshaus. Und wieder erntete er Lob. „Ein großartiger Tag für die Moslems in aller Welt“, jubilierte Großmufti Ahmad Kuftaro.
Es waren eindrucksvolle Bilder, die im Gedächtnis der Völker haften bleiben. Eindrucksvoll, wenn auch politisch gewagt, war der Besuch der syrischen Kriegs-Ruinenstadt Kuneitra. Hier, in diesem gottverlassenen Niemandsland zwischen Syrien und Israel, zwischen Arabern und Juden, „Erbfeinden“, die sich in blindem Hass bekämpfen, tönte der Friedensappell wie ein verzweifelter Aufschrei, man möge endlich innehalten und Leben an die Stelle des Todes setzen. Die Rede des syrischen Diktators Assad freilich, der den Papst prompt für sich und gegen Israel zu instrumentalisieren versuchte, sprach dem Anliegen Johannes Pauls Hohn.
Bleibt nur die Jugend, in die der alte Papst all seine Hoffnung setzt. Sorgt dafür, dass „bald der Tag kommt, an dem in diesem heiligen Land die legitimen Rechte aller Völker respektiert werden“, rief er den jungen Syrern in Damaskus zu.
Alles in allem war es eine Reise der Versöhnung, des Dialogs und des Friedens – ganz nach dem Geschmack des Weitseelsorgers, der keine Gelegenheit ungenutzt lässt, seine Kirche den Religionen, die sich auf den einen Gott berufen, näherzubringen, und der dabei keinen Schwierigkeiten aus dem Weg geht.
